Wie schon so oft in den letzten Wochen teilt Chary die Patienten, die unter den Symptomen des Virus leiden oder bei denen die Diagnose positiv ist, in drei Kategorien ein: diejenigen, denen es gut genug geht, um nach Hause zu gehen und sich dort zu erholen; diejenigen, die eingeliefert werden müssen, weil sie Sauerstoff zum Atmen benötigen; und diejenigen, die Intensivpflege und ein Beatmungsgerät brauchen.
Die meisten ihrer Patienten fallen heute in die ersten beiden Kategorien, darunter eine Frau, die wieder in die Notaufnahme kommt, positiv auf das Coronavirus getestet wurde und immer noch mit Symptomen kämpft. Chary prüft ihre Sauerstoffwerte und stellt fest, dass sie normal sind. Als sie sich darauf vorbereitet, sie zu entlassen, bemerkt sie die Angst in den Augen der Frau. Seit ihrer Diagnose sind viele Familienmitglieder der Frau auf der Intensivstation gelandet, sagt Chary später, und andere sind noch zu Hause und brauchen ihre Hilfe. Das Gleiche gilt für viele, die in der Notaufnahme ankommen und nicht krank genug sind, um ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Chary sieht zu, wie sie von dem Gedanken gequält werden, ihre Angehörigen anzustecken. „Die Aussicht, nach Hause zu gehen und dort möglicherweise das Coronavirus auf andere Menschen zu übertragen, ist für sie nur schwer zu ertragen.“
Im Bewusstsein, dass es immer andere Patienten gibt, die sie brauchen, hält Chary ihre Gefühle im Krankenhaus fest. Nach der Arbeit, allein zu Hause, ist es schwieriger, sie im Zaum zu halten. Es ist Monate her, dass sie ihren Mann, einen Kinderarzt auf der Intensivstation in Houston, gesehen hat. Sie sagt, ihr Schlaf habe darunter gelitten, weil sie ständig die elektronischen Krankenblätter ihrer Patienten auf Aktualisierungen überprüfen musste. „Ich versuche, das zu tun, bevor ich abends ins Bett gehe; morgens ist es das Erste, was ich mache. Es ist einfach ein höheres Maß an ständiger Sorge um die Patienten, die ich hatte.“
Sie macht sich um alle Patienten Sorgen, aber einige belasten sie mehr als andere. „Bei jüngeren Patienten kann es besonders verheerend sein, wenn man sieht, dass es ihnen nach wochenlangem Aufenthalt auf der Intensivstation immer noch nicht besser geht.“
Und dann ist da noch der Zustrom einkommensschwacher Patienten aus farbigen Gemeinschaften.
„Ich stelle oft fest, dass diese Patienten in einfachen Jobs arbeiten“, sagt sie. „Sie arbeiten in Lebensmittelläden, sie fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sie sind in der Pflege tätig, oder sie machen Dinge wie Hauslieferungen. Sie stehen also wirklich an der Front der Gesellschaft, genauso wie wir im Krankenhaus. Von zu Hause aus zu arbeiten ist keine Option. Und es ist auch schwierig für sie, sich sozial abzugrenzen und zu isolieren, weil sie in kleineren Wohnungen leben und oft in Mehrgenerationenhaushalten leben, in denen auch andere Menschen krank sind.“
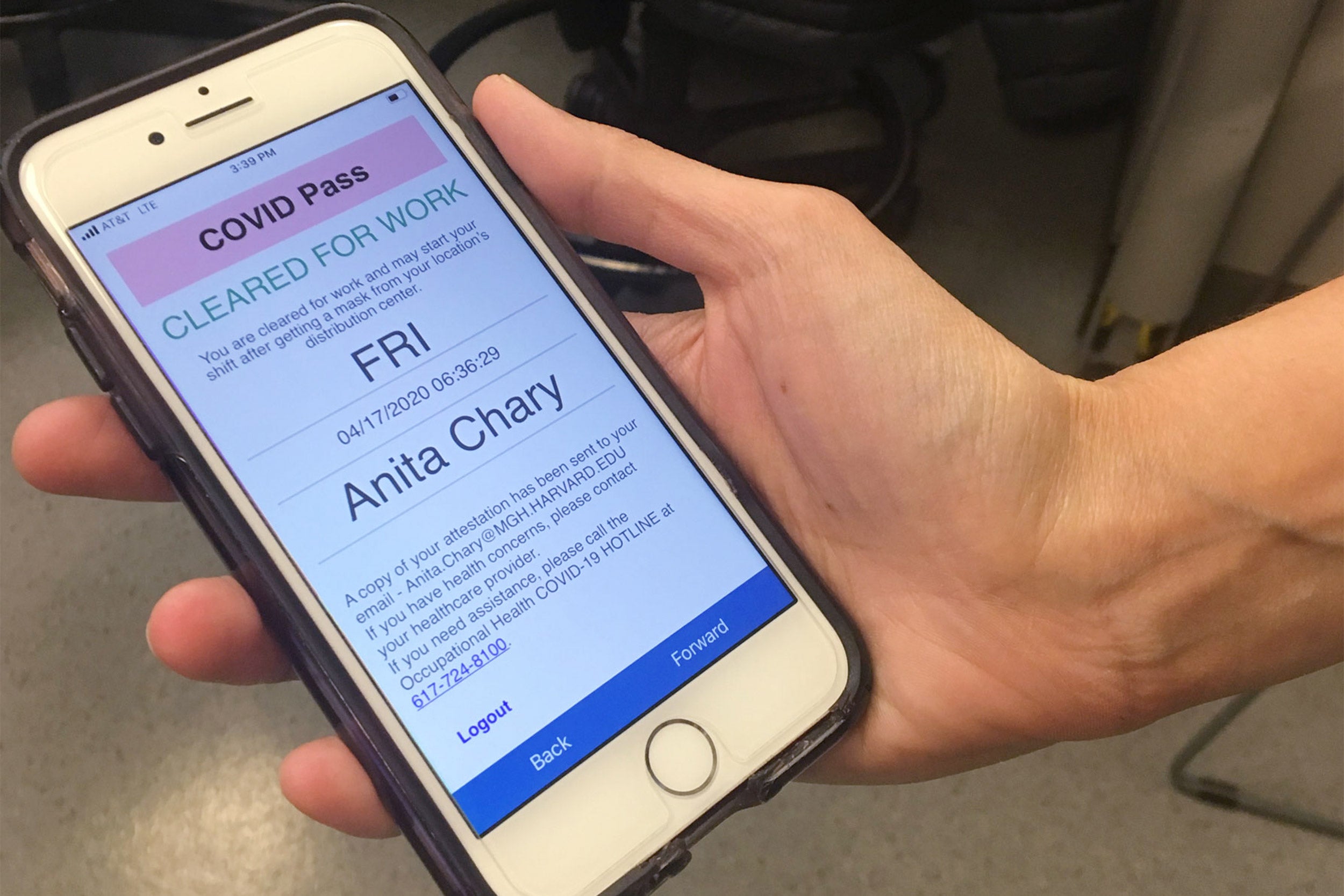
Chary weiß, dass der Tod dazugehört, wenn man ein auf Notfallmedizin spezialisierter Arzt ist, aber einige der einzigartigen Aspekte dieser Krankheit können sie immer noch erschüttern. Viele Ärzte haben festgestellt, wie schnell sich der Zustand verschlechtern kann und wie hoch die Sterberate bei Patienten ist, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind. Zu den Patienten, die Chary in den letzten Wochen durch die Krankheit verloren hat, gehörte eine ältere Frau, die sie an das Gerät anschließen musste, mit dem Luft in ihre Lungen gepumpt und wieder herausgepumpt wird. „Ich wusste, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich erholen würde, sehr, sehr gering war, und ich glaube, man spürt ein gewisses Gewicht, wenn man spürt, dass man die letzte Person sein wird, die mit jemandem spricht oder Zeit mit dieser Person verbringt, wenn sie wach und aufmerksam ist.“
Auf Drängen des Palliativ-Care-Teams des Krankenhauses lassen Chary und ihre Kollegen Patienten, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind, Nachrichten an Angehörige auf ihrem Telefon aufzeichnen, bevor sie sediert werden. „Das war eine der eindrücklichsten Erfahrungen“, sagt Chary, und ihre Stimme zittert. „Jemandem das Telefon in die Hand zu drücken und zu hören, wie er seiner Familie sagt, dass er sie liebt, und zu hoffen, dass er nach dem Absetzen des Beatmungsgeräts wieder mit seinen Lieben sprechen kann, aber er weiß es nicht.“
Allerdings schätzt sich Chary glücklich. Sie hat von Freunden und Kollegen in Städten wie New York City und Detroit Horrorgeschichten gehört, wo Kühltransporter vor den Krankenhäusern stehen und die Leichen der Verstorbenen lagern, während die Patienten in den Krankenzimmern überfüllt sind und manchmal sterben, bevor ein Arzt sie erreichen kann. Die Arbeitsbedingungen in Boston sind noch nicht so schlimm, obwohl Massachusetts ein Brennpunkt der landesweiten Epidemie ist. Bis Dienstag bezifferte das Gesundheitsministerium des Bundesstaates die Gesamtzahl der Fälle auf 58.302, mit 3.153 Todesfällen.
In Charys Notaufnahme gibt es keine Patienten, die auf den Fluren dahinvegetieren, keinen verzweifelten Mangel an persönlicher Schutzausrüstung (PSA) oder Beatmungsgeräten. Die Zahl der Patienten in der Notaufnahme des Brigham and Women’s ist in den letzten Wochen zurückgegangen. Chary, der neue Chefarzt der Abteilung, sieht normalerweise 15 bis 20 Patienten pro Schicht. Heute hat sich diese Zahl halbiert. Die Angst, sich mit dem Virus anzustecken, hat viele Patienten mit relativ leichten Verletzungen ferngehalten.
Positiv zu vermerken ist, dass Chary heute einen weiteren ihrer nicht akuten COVID-19-Patienten ins Boston Hope Medical Center schickt, wo sie sich in Isolation erholen können. Die provisorische Einrichtung mit 1.000 Betten, die für nicht kritische Patienten und Obdachlose der Stadt reserviert ist, befindet sich im Bostoner Kongress- und Ausstellungszentrum im Seaport District. „Das war eine wunderbare Alternative“, sagt Chary, die auch klinische Stipendiatin für Notfallmedizin an der Harvard Medical School ist.
Die junge Ärztin sagt, dass sorgfältige Planung der Schlüssel zur Reaktion des Brigham-Krankenhauses auf die Pandemie war – das Krankenhaus hatte 159 stationäre Patienten, von denen 90 intensivmedizinisch betreut werden mussten, wie es am Dienstag auf seiner Website hieß. Chary sagte, sie habe Zugang zu Kitteln, Handschuhen, Masken, Gesichtsschutz und Kopfbedeckungen, die sie benötige, sowie zu einem reduzierten Arbeitsplan – ein Versuch der Verwaltung, die Belegschaft so sicher und gesund wie möglich zu halten. Um die Infektionsraten weiter einzuschränken, hat das Krankenhaus in Erwartung eines Anstiegs der Coronavirus-Fälle Wände in der Notaufnahme errichtet, um einzelne Räume für die ankommenden Patienten zu schaffen.
„Das Brigham hat viel Innovation und Entwicklung betrieben und geplant, wie man am besten auf diese Krise reagieren kann“, sagte Chary, die feststellt, dass dies auch für das Massachusetts General Hospital gilt, wo sie ebenfalls in der Notaufnahme arbeitet. „Unsere Erfahrungen waren anders, weil wir tatsächlich die institutionellen Ressourcen haben, um die Patienten zu versorgen, die in unseren Notaufnahmen ankommen.“
Dennoch ist es ein ständiges Anliegen, die Exposition von ihr und ihren Kollegen gegenüber dem Virus zu begrenzen. Chary hält sich an das strenge Protokoll, das sie in den letzten Wochen befolgt hat: Sie ruft Patienten von außerhalb ihres Zimmers aus an, um festzustellen, ob sie möglicherweise infiziert sind. „Manchmal melden die Patienten der Triage-Schwester draußen etwas, aber sie leugnen die Symptome“, sagt sie. „Wenn man dann weiter mit ihnen spricht, klingt es so, als ob sie vielleicht tatsächlich Symptome haben. Von den Antworten der Patienten hängt es ab, ob Chary vor dem Betreten des Krankenhauses einen PSA-Schutzanzug anlegt.
Trotz der Vorsichtsmaßnahmen ist das Gesundheitspersonal aufgrund seiner Tätigkeit einem höheren Risiko ausgesetzt. Einem kürzlich erschienenen Bericht der Centers for Disease Control and Prevention zufolge haben sich mehr als 9.000 Angehörige der Gesundheitsberufe mit dem Coronavirus infiziert, darunter mehr als 320 am Brigham-Institut.
Eine Handvoll von Charys Kollegen hat sich in den letzten Wochen positiv getestet und sich selbst gequält. „Ich habe das Gefühl, dass ich im Moment einfach nur widerstandsfähig sein und auf das Beste hoffen muss, und ich hoffe, dass ich Glück habe“, sagt Chary, „und ich glaube, mein Pflichtgefühl, auf eine Krise zu reagieren, hat die Ängste, selbst krank zu werden, irgendwie verdrängt.“
Die Herausforderungen sind vielfältig. Chary erfährt, dass ein Krankenwagen mit einem Patienten, dessen Herz stehen geblieben ist, zum Krankenhaus rast. Sie weiß, dass es auf Minuten ankommt und dass ein Test auf Coronaviren vor Ort Stunden dauern würde. Sie geht also davon aus, dass der Patient positiv ist, und macht mit ihrer Arbeit weiter, wohl wissend, dass bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung ein größeres Risiko besteht, die Flüssigkeitströpfchen, die das Virus enthalten, zu verbreiten, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung erhöht.
„In der Vergangenheit wurde mit vielen Händen gearbeitet“, sagt Chary. „Aber beim Coronavirus müssen wir bei solchen Ereignissen sehr genau auf die Risiken achten, die sich aus der Exposition einer größeren Anzahl von Mitarbeitern ergeben könnten. Alles wird im Vorfeld genau festgelegt, wie viele Personen im Raum sein werden, wer was tun wird und wie wir die Zahl der Personen, die möglicherweise exponiert werden müssen, minimieren können.“
Da der Patient nicht wiederbelebt werden kann, bleibt die Ungewissheit über die Infektion bestehen. „Nicht zu wissen, ob die Person an den Komplikationen des Coronavirus gestorben ist, ist für die Familie und das Behandlungsteam sehr schwierig“, sagt Chary.
Die Konfrontation mit einer massiven Krise des öffentlichen Gesundheitswesens so früh in der medizinischen Laufbahn mag für viele entmutigend sein. Chary gehört nicht zu diesen Menschen. „Ich fühle mich sogar sehr privilegiert und glücklich, dass ich zu den Ärzten gehöre, die sich in dieser Zeit um die Patienten kümmern, wenn sie uns wirklich brauchen. Ich glaube, viele Menschen gehen mit dem Wunsch in die Medizin, Kranke zu heilen, und ich war noch nie so stolz darauf, Arzt zu sein.“
Und es gibt lichte Momente.